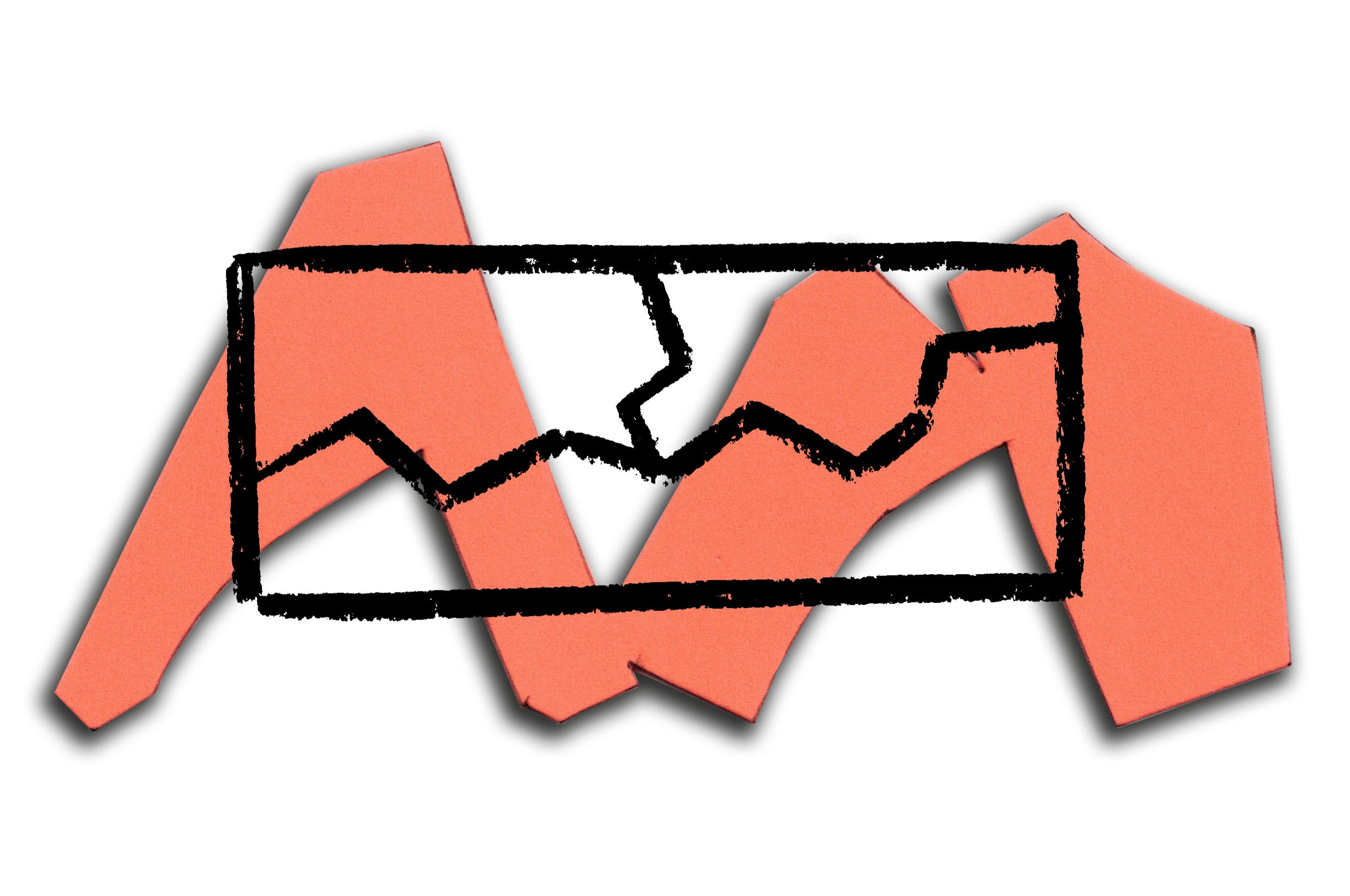
01.03.24
Kunst
Nicht nur das Schöne
Die Begegnung mit einem Werk geschieht nicht nur über das Original, sondern auch über dessen Geschichten.
Matthias Gabi (Text) und Chiara Zarotti (Illustration)
Der Künstler Rémy Zaugg hielt 1986 im Kunstmuseum Basel einen Vortrag mit dem Titel «Das Kunstmuseum das ich mir erträume oder der Ort des Werkes und des Menschen». Zaugg beschrieb detailliert, wie der ideale Ort für die Begegnung von Mensch und Werk architektonisch gestaltet werden soll. Systematisch bezog er alle Bestandteile mit ein: den Boden, die Wände, die Decke und das Licht. Zaugg erklärte, wie sich die einzelnen Räume aufeinander beziehen, wie die Eingänge optimal positioniert werden können, wie er sich die äussere Erscheinung des Gebäudes vorstellt und wo es städtebaulich anzusiedeln ist.
Bemerkenswert ist, dass im gesamten Text kein Depot, kein Archiv und keine Bibliothek zur Sprache kommt. Es gibt im Kunstmuseum, das sich Zaugg erträumt, also keinen Ort für die Sammlung, obwohl jedes Museum per Definition eine Sammlung besitzt. Die meisten Museumsgründungen gingen überhaupt erst auf eine Sammlung zurück, für die ein Ort gesucht und ein Haus gebaut wurde. Zuerst war die Sammlung, dann kam das Museum. Darin wurden Werke aus der Sammlung ausgestellt, was als Vermittlung der Sammlung galt.
Das älteste Kunstmuseum der Schweiz wurde 1879 in Bern eröffnet, Teile seiner Sammlung gehen auf die Anfänge des 19. Jahrhunderts zurück. Die 1918 eröffnete Kunsthalle Bern hingegen wurde als reines Ausstellungshaus konzipiert. An der Situation in Bern lässt sich die Unterscheidung der beiden Institutionen bestens veranschaulichen: Das Kunstmuseum legt seinen Schwerpunkt auf die eigene Sammlung, die Kunsthalle auf die Durchführung wechselnder Ausstellungen.
Von der Sammlung zur Ausstellung
Wie kommt es, dass 1986 die Beschreibung eines Kunstmuseums durch einen zeitgenössischen Künstler eher zu einer Kunsthalle passt als zu einem Museum? Eine Erklärung könnte sein, dass Kunstmuseen ab den 1960er-Jahren dazu übergingen, Wechselausstellungen mit zeitgenössischer Kunst ohne direkten Bezug zur eigenen Sammlung auszurichten. Die Ausstellungsprogramme glichen sich jenen der Kunsthallen an. Die klassische Vorstellung des Kunstmuseums als Ort einer Sammlung und der damit verbundenen Tätigkeiten wie Restaurieren und Konservieren rückte in der öffentlichen Wahrnehmung in den Hintergrund.
Der Verband der Museen der Schweiz (VMS) spricht von sechs Aufgaben, welche Museen wahrnehmen: Sammeln, Dokumentieren, Erforschen, Bewahren, Ausstellen und Vermitteln von Kulturgut. Allerdings würde heute vermutlich eine Mehrheit von Befragten angeben, ein Museum sei in erster Linie ein Ort, wo Ausstellungen gezeigt werden. Mögliche Gründe für diese Verschiebung von der Sammlung zur Ausstellung sind im wachsenden Interesse für zeitgenössische Kunst und in einer Zunahme an Sponsorengeldern für Kunstausstellungen ab den 1960er-Jahren zu suchen. Eine wichtige Rolle für die institutionelle Aufwertung der Wechselausstellung im Kunstmuseum spielte Harald Szeemann. Er war 1961 bis 1969 Leiter der Kunsthalle Bern und riss mit thematischen Gruppenausstellungen die Grenzen zwischen Hoch-, Volks- und Populärkultur ein. Mit seinem innovativen wie provokativen Programm begründete er die Idee der Ausstellung als Kunstwerk. Damit löste er einen Ausstellungsboom aus, der auch vor Kunstmuseen nicht Halt machte. Und so war es in den 1980er-Jahren, als Rémy Zaugg sich mit dem Kunstmuseum als Ort befasste, vermutlich eine verbreitete Sichtweise, ein Kunstmuseum hauptsächlich als Ausstellungsraum zu verstehen.
Die Begegnung mit einem Werk geschieht nicht ausschliesslich über die Wahrnehmung des Originals, sondern auch über Informationen und Geschichten, die sich darum herum angesammelt haben.
Ort der Originale und des Wissens
Wie kann heute die Begegnung von Mensch und Werk im Kunstmuseum gestaltet werden? Die Fixierung auf den Ausstellungsraum erscheint nicht mehr zeitgemäss. Kulturelle Teilhabe erschöpft sich nicht im Ausstellungsbesuch. Die Begegnung mit einem Werk geschieht nicht ausschliesslich über die Wahrnehmung des Originals, sondern auch über Informationen und Geschichten, die sich darum herum angesammelt haben. Die Begegnungen von Mensch und Werk sind vielfältig und mehrschichtig und geschehen in physischen wie virtuellen Räumen. Heute gibt es einen Konsens darüber, dass all diese Räume barrierefrei einem möglichst breiten Publikum offenstehen sollen.
Auch die Zugänglichkeit zum grossen Wissensschatz eines Museums kann erweitert werden. In der digitalisierten Informationsgesellschaft, in der wir heute leben, kommt dem niederschwelligen Zugang zu Wissen eine besondere Bedeutung zu. Universitäten setzen dazu auf Open Access und Open Science. Dahinter steckt die Überzeugung, dass Forschungsdaten und Informationen, die mit der Unterstützung öffentlicher Mittel entstehen, der Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung gestellt werden sollen. Vorstellbar wäre, dass sich auch Museen, die von der öffentlichen Hand mitfinanziert werden, diesem Prinzip verpflichten und dieses auf ihre spezifischen Eigenschaften anpassen.
Stellt man sich das Museum als Gefäss vor, braucht dieses drei Eigenschaften: Es muss wachsen können, um weitere Bestände in sich aufzunehmen; es muss für Menschen und Informationen möglichst durchlässig sein, um als offener Ort der Originale und des Wissens zugänglich zu sein, und zwar physisch wie digital; und es muss gleichzeitig robust und bruchsicher sein, um seine Sammlungsobjekte möglichst gut zu schützen, um diese auch für nachfolgende Generationen zu erhalten.
Unerträglich und wertvoll
Museen stehen heute vor der schwierigen Aufgabe, einer Vielzahl widersprüchlicher Bedürfnisse gerecht zu werden. Dazu gehören die Gegensätze zwischen Schutz und Zugänglichkeit, Elitarismus und Offenheit, Akademismus und Popularität, Original und Reproduktion, Ruhe und Lebhaftigkeit, Beständigkeit und Zeitgeist, Bewahrung und Benutzung, Transparenz und Verschwiegenheit. Auch darf nicht vergessen gehen, dass in manchen Museen problematische und unrechtmässige Bestände vorhanden sind. Ein Sammlungsobjekt kann gleichzeitig ein «unerträgliches wie wertvolles Dokument sein», wie es die auf Provenienzforschung spezialisierte Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy formuliert. So, wie wir in unserem Gedächtnis nicht nur das Gute behalten, liegt in den Museen nicht nur das Schöne. «Wer das, was schön war, vergisst, wird böse. Wer das, was schlimm war, vergisst, wird dumm», schrieb Erich Kästner.
Im Gefäss Museum kommen das Alte und das Neue zusammen, das Vergangene, das Gegenwärtige und das Zukünftige treffen aufeinander. Dieses Gefäss ist Teil unseres kollektiven Gedächtnisses. Wir sollten ihm Sorge tragen, es hilft uns, materielle Erinnerungen wachzuhalten, unsere Gegenwart besser zu verstehen und das kulturelle Erbe weiterzugeben.

