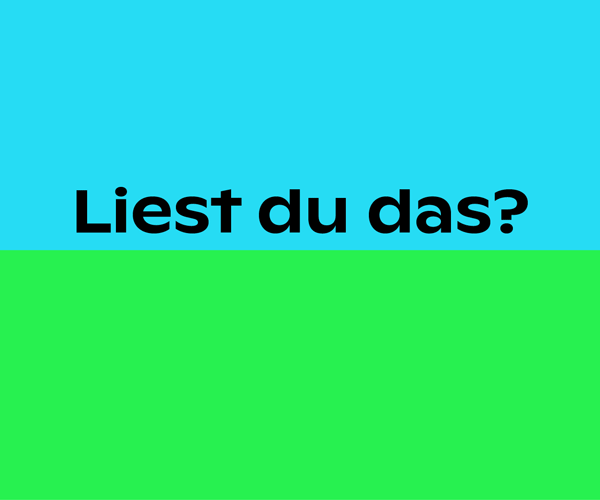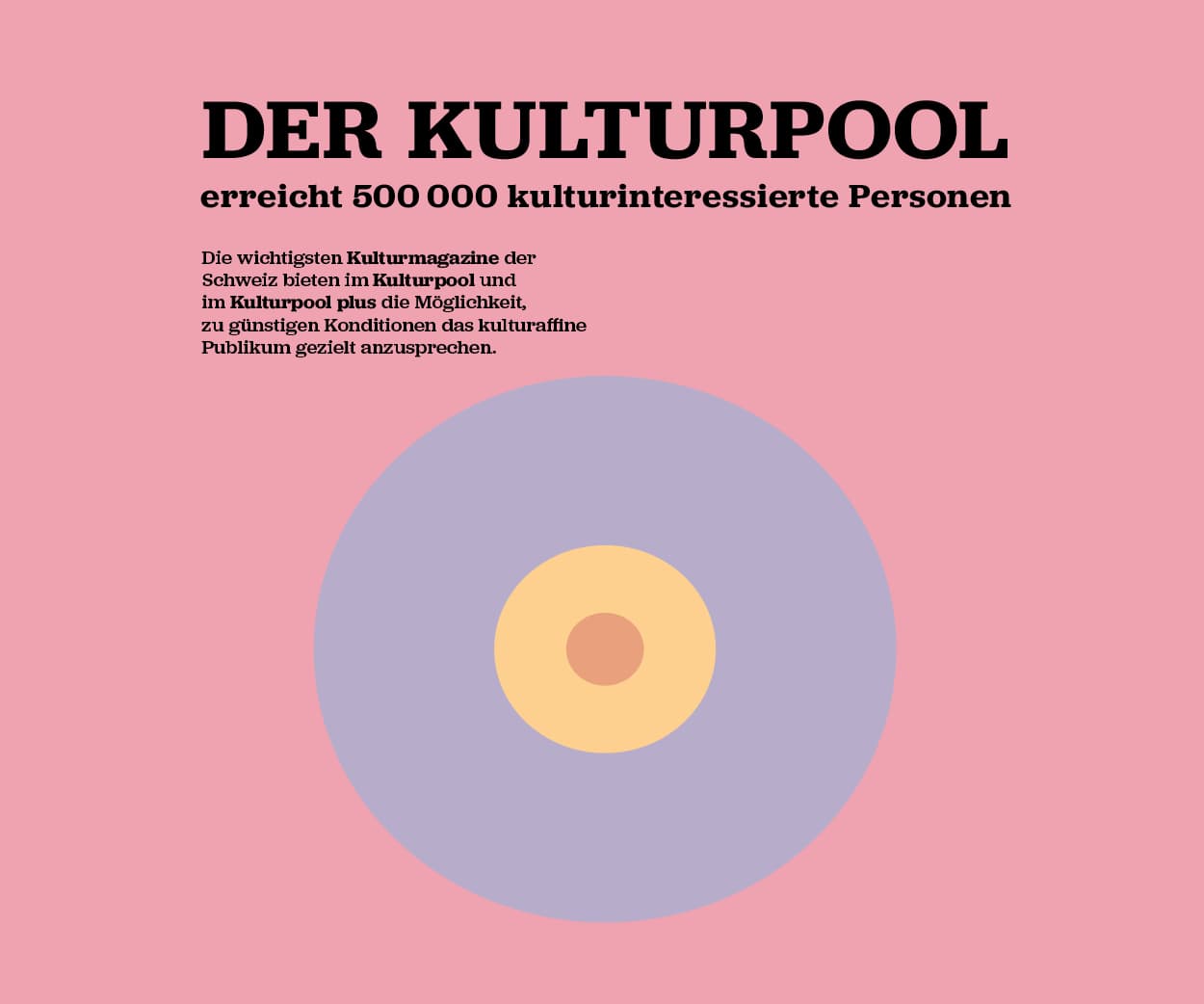10.03.25
Film
Jede Grenze eine Geschichte
Ein Soldat, der keiner sein wollte. Kinder, die zu Ausländern gemacht wurden. Geschichten, die wie Wolle gesponnen werden. Die Filme von Nikola Ilić, Selin Besili und Mirjam Landolt verhandeln Territorien, und die Frage, warum es sie überhaupt gibt. Jetzt wurden sie mit dem Innerschweizer Filmpreis ausgezeichnet.
Dominic Schmid (Text)
Eigentlich geht es so gut wie immer um Territorien. Wobei ein Territorium einfach ein Gebiet ist, das mit einer oder mehreren Geschichten verknüpft ist – beziehungsweise mit diesen ausgestattet wurde – aus unterschiedlichen Gründen: Orientierung, Identität, Heimat, Grundbesitz, Souveränität, Staatenbildung, Wegweisungsrecht, etc. Nichts davon basiert auf objektiven Fakten, keine Staatsgrenze lässt sich von physikalischen Tatsachen herleiten, und niemand kann Land «besitzen», ausser im allerwörtlichsten Sinne, was aber schnell einmal kalt und langweilig wird.
Stattdessen eben Geschichten: frei erfundene, behauptete, glaubwürdige und solche, bei denen mit der Androhung von Gewalt nachgeholfen werden muss. Manche sind so alt, dass man längst vergessen hat, wer sie zuerst erzählt hat. Manche wurden von schlecht informierten oder befangenen Erzähler:innen aufgeschrieben, manche wurden zu Gesetzen, zum Vorwand, die anwesenden Menschen zur Gemeinschaft zu verpflichten und den abwesenden den Zutritt zu verwehren. Weil sie – angeblich – nicht zur Geschichte gehören.
*
Man gibt ihnen Namen, den Territorien wie den Menschen, die zu ihnen gehören, die sie besitzen oder besetzen. Schweizer, Südosteuropäer, Sowjetbürger, Osmanen, Jugoslawen, Serben, Kosovaren, Albaner, Luzerner, Innerschweizer, Europäer, Römer, Pikten, Gälen, Wikinger, Schotten, Briten. Die Bezeichnungen überlappen oder schliessen sich gegenseitig aus, lösen sich voneinander ab – manchmal mittels Gewalt, manchmal diplomatisch, manchmal anhand neuer archäologischer Entdeckungen. Dass es sich bei all diesen Begriffen streng genommen um Fiktionen handelt, ändert nichts an ihrer Macht, vergangene, gegenwärtige und zukünftige Wirklichkeiten zu bestimmen. Und so geht es eigentlich fast immer auch um Geschichten.
Wer schafft es schon, über Monate nichts anderes zu tun, als die eigenen Schuhe anzustarren, und welche Nachwirkungen bringt ein solcher Akt mit sich?
Zum Beispiel um diese. Der erste Nachweis der Familie Koechlin stammt aus dem Elsass im Jahr 1595. Ihre unzähligen Erfolge – ganze europäische Industriezweige lassen sich auf die Koechlins zurückführen – werden abwechselnd begründet mit radikal gelebter protestantischer Ethik und mit der Familientradition, die Nachkommenschaft in Schweizer Internate zu schicken.
Rudolf Albert Koechlin, geboren 1859 im «Badischen», verdiente sein vieles Geld als Industrieller, als Banker und mit zahlreichen Verwaltungsratsmandaten. Sein «Wirkungsfeld», hiess es Anfang der Nullerjahre in der NZZ, reichte «weit über Basel hinaus bis nach Russland». Im Jahr 1997 schliesslich, achtzig Jahre nach Rudolf Alberts Tod, gründeten seine Erb:innen (ein anderes grosses Thema, filmisch soeben im Bernischen prominent behandelt) eine Stiftung. Letztere engagiere sich «in den Bereichen Soziales, Bildung, Kultur, Wirtschaft und Umwelt», wie es auf der Website heisst, wobei im Fokus dabei «stets das Gemeinwohl» stehe. Nämlich das der Innerschweiz, definiert als jenes Territorium, das aus geschichtlich bedeutsamen Gründen die Schweizer Kantone Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden und Luzern umfasst. Alle zwei Jahre vergibt nun diese nach Albert Koechlin benannte Stiftung eine Gesamtpreis-
summe von 600 000 Franken an die Macher:innen von Filmen, die in besagtem Gebiet leben oder arbeiten. Das sind 100 000 Franken mehr als beim (alljährlich vergebenen) Schweizer Filmpreis. Bei einer Eingabe für den Innerschweizer Filmpreis ist eine «aktuelle Wohnsitz- respektive Geschäftssitzbestätigung» unabdinglich. «Ein rein thematischer Innerschweizer Bezug», da ist das Reglement deutlich, «reicht nicht».

*
Wann und wo man lebt, ist zentral. Nikola Ilić, dessen kurzer Essayfilm «Exit Through the Cuckoo’s Nest» dieses Jahr mit 50 000 Franken bedacht wurde, wuchs Anfang der 1990er-Jahre in Belgrad auf. Jener Gegend also, wo nach gut 50 Jahren relativer Stabilität die Frage nach dem Territorium wieder unvermittelt ihre mörderische Relevanz erlangte. Wo männliche Jugendliche, die lieber unschuldig skaten, Punk hören und träumen wollten, zur Armee eingezogen wurden, um dort die Integrität der nur kurz unter diesem Namen existierenden «Bundesrepublik Jugoslawien» mit teils kriegsverbrecherischen Methoden durchzusetzen.
Aufgeklärten, pazifistischen und vom nationalistischen Virus verschonten Männern wie Ilić blieben nur wenige Möglichkeiten, sich dem Töten und Sterben im Namen der Nation zu entziehen. Der waffenfreie Dienst beispielsweise, der einen aber weder wirklich aus der Schusslinie nahm noch das Trauma ersparte, Freunden und «Feinden» beim Sterben zuzusehen. Oder aber die vorgetäuschte Geisteskrankheit, die allerdings sehr viel schauspielerisches Durchhaltevermögen verlangt (und ausserdem mit dem aus Roman und Film bekannten Problem des «Catch-22» belegt ist). Wer schafft es schon, über Monate nichts anderes zu tun, als die eigenen Schuhe anzustarren, und welche Nachwirkungen bringt ein solcher Akt mit sich?
Die Bilder und Töne von «Exit Through the Cuckoo’s Nest», viele davon eigene Aufnahmen aus jener Zeit, wurden vom Filmemacher radikal verfremdet – eingefärbt, verzerrt, entkontextualisiert – mutmasslich, um sie dem Geisteszustand der erlebten Zeit anzugleichen. Ein autobiografisches Filmexperiment, so gelungen wie verstörend, gerade in seinem letzten Sprung in die Gegenwart, wo einmal mehr deutlich wird, dass sich auch die schlimmsten Geschichten stets wiederholen.

*
Thematisch verwandt, formal verspielt, aber doch etwas weniger radikal ist «Unser Name ist Ausländer», Preisträger in der Kategorie Abschlussfilm, dotiert mit 20 000 Franken. Wie Nikola Ilić kombiniert auch Selin Besili eigenes, unbefangenes Videomaterial aus der Jugend mit neu gemachten Aufnahmen, die von eigenwilliger, aber offenherziger Poesie sind. Es handelt sich um eine Art Selbstporträt von vier in der (Inner-)Schweiz aufgewachsenen Geschwistern kurdischer Herkunft. Der Film stellt die Frage, was es für Kinder bedeutet, wenn ihnen implizit und explizit die Zugehörigkeit zu einem Ort aberkannt wird, obschon sie nie einen anderen ihr Zuhause genannt haben. Die Gründe, so willkürlich wie bekannt, sind die gleichen wie überall: andere Haarfarbe, andere Namen, andere Familienrituale, andere Muttersprache. Letztere kann man offenbar, wie sich eine Protagonistin traurig erinnert, aktiv verlernen. Für die Brüder sei die Ablehnung, die ihnen seit der Kindheit entgegenschlägt, indessen so schlimm geworden, dass es sie «gar nicht mehr stört». Heutzutage, gibt ein anderer mit inspirierendem Selbstbewusstsein zu Protokoll, lasse er sich willkommen fühlen, wo auch immer er sei.

*
Dass das Verhältnis zwischen dem Territorium und seinen Geschichten stets auch eines sein könnte, das die vermeintlichen Aussenseiter:innen, statt sie auszugrenzen, in die mythischen Strukturen des Ortes mit einflicht, demonstriert auf eine sehr poetisch-sensuelle Weise Mirjam Landolt mit dem ebenfalls prämierten Film «Between Tides», der fast ausschliesslich aus Naturaufnahmen und Voiceover besteht. Vielleicht hilft es, dass es sich bei Islay, dem porträtierten Ort, um eine relativ abgelegene Insel westlich des schottischen Festlands handelt, auf die sich «Fremde» nur selten zu verirren scheinen. Vorsorglich erzählt man sich also Geschichten über die schottische Version der Meerjungfrau – nur dass es sich bei den Selkies um Robben handelt, die ihr Fell abgelegt, zu schönen Menschen werden. Gefährlich sind sie in der Regel nicht (wie die meisten Besucher:innen), im schlimmsten Fall gehen sie Liebesbeziehungen mit den Inselbewohner:innen ein, um diesen dann nach vielen Jahren, von der Sehnsucht nach der Heimat im Meer gepackt, das Herz brechen müssen. Nicht von ungefähr wird in «Between Tides» das Erzählen von Geschichten mit dem Spinnen von Wolle in Verbindung gebracht, wobei die so gesponnenen Fäden als Bindeglieder zwischen den Menschen und der Landschaft dienen. So werden Netze und Netzwerke geknüpft, immer wieder von Neuem, wie sich auch Geschichten immer wieder neu erzählen lassen, in Variationen und mit anderen Protagonist:innen. Sie möchte nur an einem Ort leben, meint die Erzählerin im Off mit einem Lachen, von dem aus sie von Zeit zu Zeit den Mond betrachten kann. Doch wo, ausser auf dem Mond selbst, liegt der Ort, auf den dies nicht zutreffen würde?