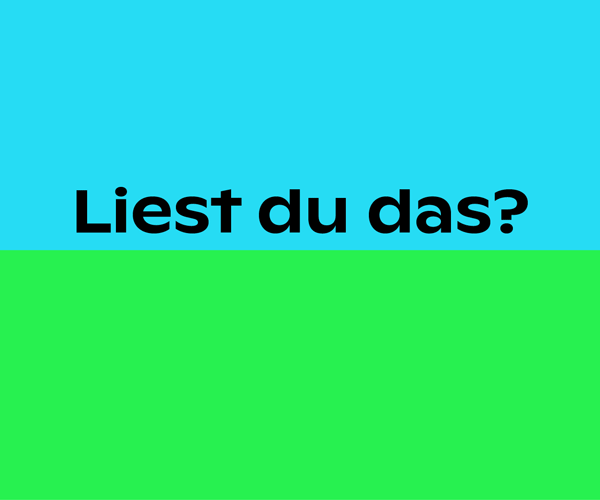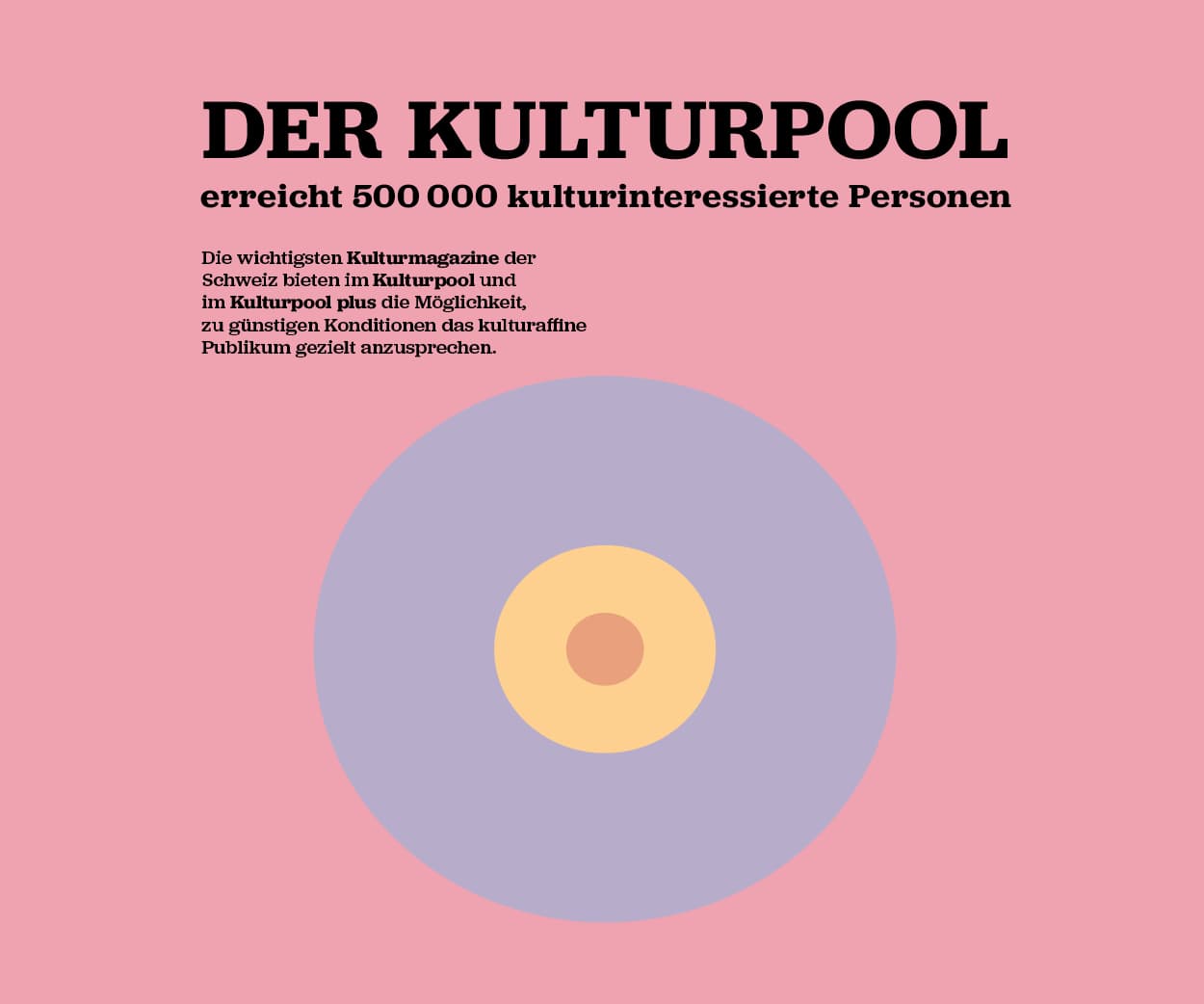01.04.25
Theater
Hoffnung und Subversion
Mit «Requiem für einen Gefangenen» verspricht das Luzerner Theater einen Abend über Freiheit, Hoffnung und Menschenwürde. Eine komplexe Konstellation, die sich den ganz grossen Fragen annehmen möchte.
Daniel Riniker (Text) und Ingo Hoehn (Bilder)
Das Luzerner Theater zeigt mit «Requiem für einen Gefangenen» einen Doppelabend, an dem sich die Oper «Il prigioniero» von Luigi Dallapiccola und das «Requiem D-Dur» von Jan Dismas Zelenka begegnen. Das ist erstmal eine aufregende Setzung, die auf den ersten Blick einen spannungsvollen Abend zwischen zwei sehr unterschiedlichen Werken verspricht.
Der italienische Modernist Dallapiccola begann 1945 die Arbeit an seiner Oper unter dem Eindruck von Faschismus und Weltkrieg, um «die Tragödie unserer Zeit zu behandeln», wie es im Programm steht. Zelenkas Requiem dagegen entstand 1733 am Dresdner Hof als Totenmesse für den Kurfürsten August den Starken. Zwölftonmusik trifft also auf Barock, Nachkriegszeit auf höfischen Pomp, eine Oper auf eine Messvertonung. Und obendrauf wird die Produktion auch noch von einer Ausstellung des schweizerisch-tschechischen Künstlers Pravoslav Sovak begleitet. Der wie Zelenka aus Böhmen stammende Künstler floh 1968 nach dem Prager Frühling in den Westen und lebte bis zu seinem Tod 2022 in der Innerschweiz. Damit ist der Doppelabend eigentlich eine Ménage-à-trois, die einen entsprechend weiten Bogen zu schlagen versucht: Freiheit, Hoffnung und Menschenwürde werden als Themen genannt, die dieses Trio am Luzerner Theater zusammenführen soll.
Düsterer Karneval
Den Anfang macht «Il prigioniero». Dallapiccolas kurze, einaktige Oper mit Prolog spielt im Spanien des 16. Jahrhunderts in den Kerkern der Inquisition. Unter der Regie von Aniara Amos ist eine Interpretation entstanden, die als alptraumhafte Innenperspektive eines Gefolterten funktioniert. Der titelgebende Gefangene, ein Widerstandskämpfer, der den Folterknechten des Grossinquisitors in die Hände gefallen ist, fiebert und geistert als riesige Videoprojektion von der Rampe. Mit dem Feuertod auf dem Scheiterhaufen vor Augen, erleidet der Gefangene die ultimative Folter: Als ihn sein Peiniger plötzlich mit «Fratello» anspricht, schöpft er plötzlich Hoffnung auf Freiheit und Erlösung.
Amos’ düsterer Karneval kostet jede schmerzhafte Zuckung des Protagonisten in grotesker Übergrösse aus. Zwölftonreihe für Zwölftonreihe schraubt sich der Doppelabend über Freiheit und Hoffnung damit erstmal hinunter in die Tiefen infernalischer Folter. Nach 45 Minuten wird das Publikum in die Pause entlassen. Die gemarterten «Fratello»-Rufe hallen einem im Kopf nach – genau wie die Dramaturgin des Abends, Pia-Rabea Vornholt, es in der Stückeinführung prophezeit hatte.

«Dallapiccola wollte mit diesem Werk den Zweifel auf die Opernbühne bringen», erklärt Vornholt im Gespräch. Zweifel nämlich, ob es in einer Welt des Totalitarismus überhaupt so etwas wie Freiheit geben könne oder ob die Hoffnung auf Freiheit immer nur eine Illusion sei.
Die Setzung des Luzerner Theaters von «Requiem für einen Gefangenen» sieht nun vor, dass nach der Pause mit Zelenkas «Requiem D-Dur» die Totenmesse für Dallapiccolas Gefangenen gefeiert wird. Wie es die Dur-Tonart vermuten lässt, ist diese Messvertonung nicht nur eine traurige Angelegenheit, sondern zelebriert auch prachtvoll und farbenfroh den barocken Kunstfürsten, der zugleich auch ein Kriegstreiber und Gewaltherrscher war. «So kommt es zur Gegenüberstellung von Dallapiccolas Kritik am Totalitarismus und Zelenkas Requiem, das selbst Produkt einer absolutistischen Herrschaft ist», sagt Vornholt. «Dallapiccolas Idee einer trügerischen Tonalität wird dadurch gewissermassen weitergesponnen.»
Fröhliche Totenmesse
Nach der Pause ist unverändert ein riesiges, weisses Kreuz auf der Bühne zu sehen. Hinzugekommen ist ein Aschehaufen, der vom Scheiterhaufen des ersten Teils übrig geblieben sein könnte. Aber dann ist schon Schluss mit der Kontinuität. Begleitet von den wundervollen Melodien dieser aussergewöhnlich fröhlichen Totenmesse, macht sich das Team des Theaters ganz unzeremoniell an den Umbau der Bühne. Während des gesamten Requiems sind Techniker:innen dabei zu beobachten, wie sie den Bühnenraum mit Schnee, Regen, Wind und Wäldern immer wieder neu transformieren. Das Team um den Bühnenbildner Valentin Köhler trägt dieses Visual Poem gemeinsam mit einer Kinderschar und einer grossen Portion Nonchalance vor, während Chor und Solist:innen die meiste Zeit im Orchestergraben verborgen bleiben. Gerade in der Zusammenschau mit «Il prigioniero» scheint diese pointierte Vision eines Requiems auch den für seine Prunksucht berüchtigten August den Starken durch den Kakao zu ziehen. Köhler trifft einen ironisch-subversiven Ton und macht auch vor christlichen Motiven nicht Halt: Die berühmte Isenheimer Auferstehung Christi schwebt ohne Kopf über einer riesigen Pietà, die in der Mitte gespalten ist.
Im fulminanten Schlussbild entsteigt dem erwähnten Aschehaufen dann noch ein geflügeltes Kind, das sowohl als ironische Übertreibung als auch als ernstgemeinter Hoffnungsträger lesbar ist.
Irgendwo im Themenkosmos
Mit Amos’ Interpretation von «Il prigioniero» und Köhlers Version des «Requiem D-Dur» krachen inszenatorisch und musikalisch verschiedene Welten aufeinander. Die klassische Moderne und der höfische Barock bilden zwischen Hyperexpressionismus und Bühnentechnik ein eklektisches Stimmungsbild, in dem mitunter philosophische Fragen angeschnitten werden. Allerdings ergibt sich aus der Konstellation des Doppel- (oder Dreifach-)Abends keine tiefenscharfe Perspektive auf Freiheit, Hoffnung oder Menschenwürde. Zu beziehungslos stehen die Handschriften von Amos und Köhler zueinander und zu wenig hat Dallapiccola letztendlich mit Zelenka am Hut. Die Ausstellung von Pravoslav Sovak ist nicht uninteressant, verbirgt sich aber auf der Galerie des Foyers und ist inhaltlich kaum mehr als ein Satellit, der auch noch irgendwo im Themenkosmos hängt.
Dieses Konstrukt aus Ausstellung, Oper und Requiem ist vor allem musikalisch sehr reizvoll, aber inhaltlich wirkt alles etwas beliebiger, als einen das Programm glauben machen möchte.