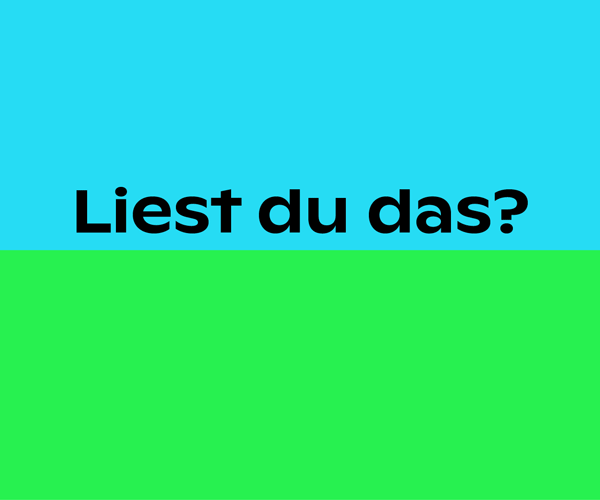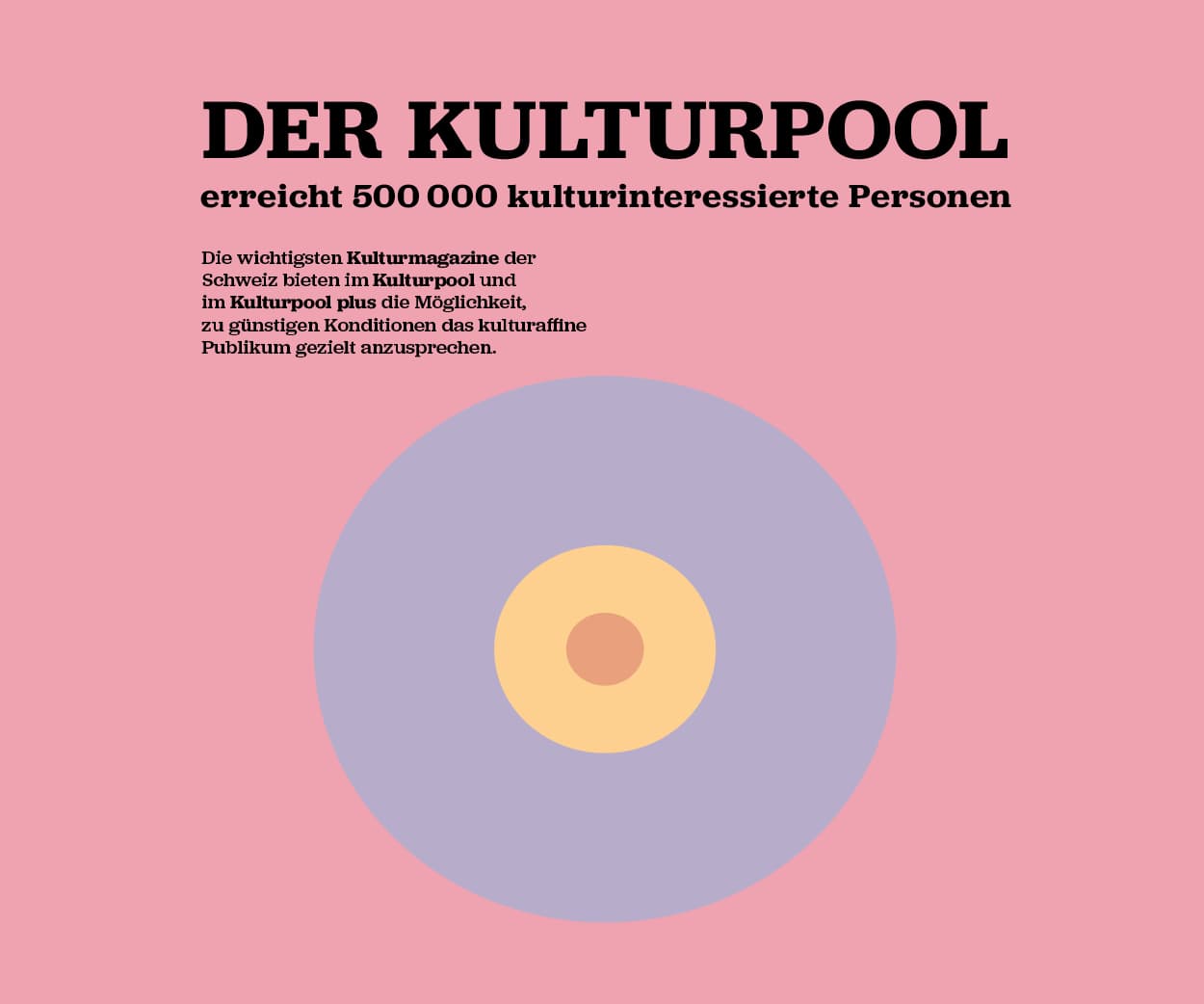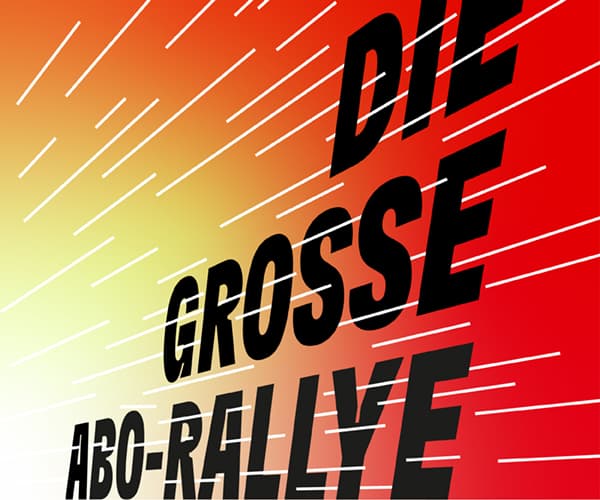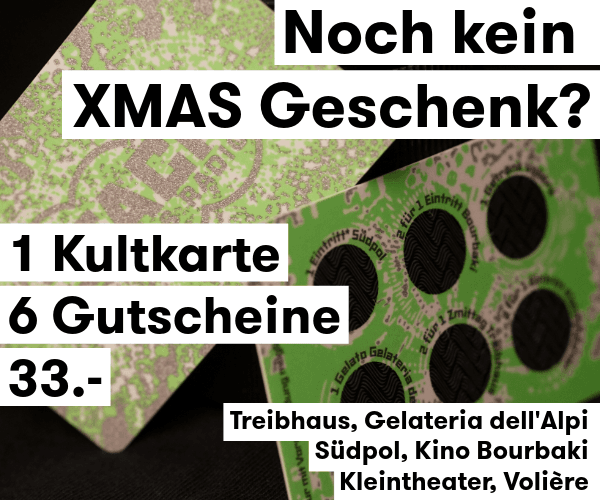01.04.25
Literatur
Sätze bauen Landschaften
Seit vielen Jahren schreibt Beatrice von Matt über Literatur. Und immer wieder zieht es sie zum Innerschweizer Autor Meinrad Inglin, der ihr Schaffen prägte. Ein Gespräch mit der Grande Dame der Schweizer Literaturkritik.
Tuğba Ayaz (Interview) und Sam Aebi (Bilder)
Frau von Matt, Sie haben im jüngst erschienenen Band «Sämtliche Erzählungen» Meinrad Inglins das Nachwort verfasst. Sie sind überaus vertraut mit seinem Werk, kannten ihn persönlich. Was beeindruckte Sie, als Sie Inglin zum ersten Mal lasen?
Ich bin in Stans aufgewachsen und fand meine Gegend bei ihm gestaltet. Er zeigte mir die Innerschweiz, die für mich Alltag gewesen war, in einer neuen Dimension. Das hat mich sehr eingenommen. Als Erstes las ich «Die graue March». Das Buch spielt in einem Hochtal unweit von Schwyz, der Ort wird nicht genannt. Die Hauptfiguren sind arme Bergbauern und Tiere. Beide sind Jäger und Gejagte. Haben eine kümmerliche Lebensbasis und kämpfen dagegen an. Es gibt auch eine Frauenfigur, die sich daraus befreit. Das beeindruckte mich alles. Ebenfalls die geformte Sprache, die genauen Details, die beschrieben sind.
Wie stiessen Sie überhaupt auf Meinrad Inglin?
Erst als ich in Zürich studierte, durch den Kritiker Werner Weber und Emil Staiger, meinen Professor an der Universität. Am Gymnasium in Luzern hörte ich den Namen Inglin nie – obwohl er Innerschweizer war. Er kam in Zürich besser an als in Luzern. Das sagte er selber.
Warum?
Er meinte, die Stadtluzerner hätten das Gefühl, die Leute aus den Ländere seien vielleicht nicht ganz ihrer Stadt würdig. Sein erster Roman «Die Welt in Ingoldau» hatte 1922 ja auch einen mächtigen Skandal ausgelöst. Das Werk wurde von der Kanzel herab verflucht. Der Hauptvorwurf lautete, die sexuellen Nöte der Heranwachsenden seien zu explizit beschrieben. Inglin wurde bedroht und musste von Schwyz nach Zürich fliehen.
Sie bezeichnen «Die Welt in Ingoldau» als den Innerschweizer Roman schlechthin. Warum?
Er handelt von einer vergangenen Epoche, die ich in Stans selber noch erlebt habe. Ein Dorfleben geprägt von rigoroser Kirchenmentalität, vom Patriarchat. Da sind Frauenfiguren, die sich ihres Werts, ihrer Fähigkeiten bewusst werden sollen. Dieser Welt hält Inglin den Spiegel vor. Aber nicht nur: Es gibt da auch Poesie, Jugendliche, die in der Natur ihr Zauberland finden.
Die Natur ist in Inglins Literatur zentral. Was prägt sein Schreiben darüber?
Er schreibt über die Voralpenlandschaft der Innerschweiz. Er schildert nicht bloss, was er sieht. Seine Sätze bauen die Landschaft nach. Er fügt sie zu einer literarischen Komposition. Die Natur wird den Lesenden so wunderbar nahegebracht, auch als ästhetische Erfahrung.
«Bei ihm fliehen junge Leute oft vor gesellschaftlichen Nöten in die Natur – wie einst er selbst. Und finden dort Geborgenheit.»
Warum war ihm die Natur als Motiv wichtig?
Sie war für ihn der Zufluchtsort in seiner schwierigen Kindheit. Er beschreibt in «Werner Amberg» so schön: Er sei nicht in Bett und Stube auf die Welt gekommen, sondern in einem Moosbettchen, irgendwo hoch oben gegen die Baumgrenze hin. Und nur dort sei er ganz zugehörig, nicht im gestrengen Dorf. Bei ihm fliehen junge Leute oft vor gesellschaftlichen Nöten in die Natur – wie einst er selbst. Und finden dort Geborgenheit.
Kürzlich schrieben Sie in einem Artikel, dass Inglins Roman «Urwang» Ihnen dabei hilft, den menschengemachten Verlust der Natur zu reflektieren. Inwiefern?
Dieser Artikel erschien kurz vor der Abstimmung zur Biodiversitätsinitiative. Ich fand, wir könnten bei Inglin einhaken. Er beklagte den Verlust der Natur bereits in den Fünfzigerjahren vehement, als man dank wirtschaftlichem Aufschwung nur noch Autobahnen bauen und Täler unter Wasser setzen wollte. In «Urwang» stellt er einerseits die Vertreibung der Bauernfamilien dar, andererseits sieht er die Vertreter der Wirtschaft nicht bloss als Zerstörer. Er denkt über Dilemmata nach.
Sie sind Autorin einer Meinrad-Inglin-Biografie, die 1976 erschienen ist. Sie enthält mündliche Zeugnisse des Autors. Wie war er als Mensch?
Zugewandt, offen. Als ich Bücher von ihm Ende der Sechziger rezensierte, damals in den «Schweizer Monatsheften», reagierte er gelegentlich mit einem freundlichen Echo. Er schickte mir auch eine Sonderausgabe von «Wanderer auf dem Heimweg» mit einer liebenswürdigen Widmung. Darauf war ich stolz. Kennengelernt habe ich ihn 1969 in Stans, anlässlich der Verleihung des Innerschweizer Kulturpreises an seinen Freund, den Bildhauer Hans von Matt. Da war er bereits 76 Jahre alt.
Wie entstand der persönliche Austausch?
Überraschenderweise war er einverstanden mit meinem Biografie-Projekt. So traf ich ihn immer wieder in Schwyz in seinem Haus, schrieb unsere Gespräche mit. Irgendwann zeigte er mir sein Archiv. Er öffnete Truhen und Schränke, in denen alles perfekt geordnet war: erste Fassungen, zweite Fassungen, Briefe, Fotos. Er sagte, er würde mir alles überlassen, aber ich dürfe es erst nach seinem Tod einsehen und holen. Darüber verfügte er testamentarisch.
Erinnern Sie sich an die letzte Begegnung mit ihm?
Ja, das war im November 1971 im Krankenhaus. Er war geistig ganz präsent, offenbar bis zuletzt. Ich weiss noch, dass er Kiplings «Dschungelbuch» las. Er verstecke es sonst vor Besuchern, verriet er. Die müssten nicht wissen, dass er ein Kinderbuch lese. Doch da war sie wieder, die wilde Natur.
Ihr Werk als Germanistin und Kritikerin bildet über Jahrzehnte Schweizer und internationale Literatur ab. Was führte Sie zum Journalismus?
Ich unterrichtete während des Studiums gelegentlich an der Kantonsschule Luzern. Dachte, das sei der gängige Weg. 1964 heiratete ich und wurde schwanger. Einer der beiden Rektoren fand, eine schwangere Frau solle nicht unterrichten. Ich suchte eine Lösung, dachte erst gar nicht an Journalismus, obwohl ich immer gern schrieb. Der Zufall wollte es, dass mein ehemaliger Deutschlehrer an der Kantonsschule beim «Vaterland» Kulturredaktor geworden war. Die Zeitung war weit verbreitet. Er sagte: Schreib bei mir, was du willst.
Worüber schrieben Sie?
Über Theater vor allem. Ich durfte ans Berliner Theatertreffen. Erlebte dort Eugène Ionescos «Stühle» und die Uraufführung von Peter Handkes «Publikumsbeschimpfung». Das war eine grosse Theaterzeit. Gerade auch am Schauspielhaus Zürich. Ich erinnere mich besonders deutlich an «Die Ermittlung» von Peter Weiss 1965, an die Uraufführung von Friedrich Dürrenmatts «Meteor» 1966. Ich verfasste zudem Filmkritiken und Rezensionen. Später schrieb ich auch für die «Zürichsee-Zeitung» und das «Aargauer Tagblatt». Doch irgendwann wurde es mir zu anstrengend. Da war ja auch meine Familie. Nach einer Aufführung musste nachts der Artikel her und morgens um sechs per Expressversand auf die Post, damit er am nächsten Tag in der Zeitung erscheinen konnte. Zudem wollte ich da bereits vermehrt über Literatur schreiben.

So wurden Sie Literaturkritikerin der NZZ?
Ich schrieb dann regelmässig als Freie für die NZZ. 1984 fragten sie mich, ob ich die Literaturredaktion übernehmen wolle. Da war Schweizer Literatur ein Nebenschauplatz, wenn auch ein wichtiger. Ich porträtierte Schriftstellerinnen wie Adelheid Duvanel, Gertrud Leutenegger, Margrit Schriber oder Erica Pedretti. Mir war es wichtig, mich mit ihren literarischen Motiven zu befassen. Etwa mit ihrer Auseinandersetzung mit Kindheit, ihrer Rolle als Frau, der bestimmte Berufe verwehrt bleiben. Solches floss später auch in mein Buch «Frauen schreiben die Schweiz» ein. Ebenso Gewicht hatte internationale Literatur. Ich besuchte Peter Rühmkorf in Hamburg, Inger Christensen in Kopenhagen, Hugo Claus in Gent, Harry Mulisch in Amsterdam, Friederike Mayröcker in Wien – gerade sie traf ich immer wieder. Wir hatten viel Platz im Blatt: am Wochenende beispielsweise bis zu acht Seiten «Literatur und Kunst».
Wer die Medien nur in der Krise kennt, kann sich das schwer vorstellen. Wie blicken Sie auf die heutige Literaturkritik?
Mich stört, wie wenig überhaupt noch besprochen wird. Der ökonomische Druck ist spürbar. Es gibt immer wieder grossartige Rezensionen. Doch fällt mir auf, dass oftmals nur der Inhalt des Buches zusammengefasst ist, kaum gepaart mit einem Urteil. Dass oft die politische Haltung allein zählt. Hingegen liest man in Rezensionen wenig über die Machart, den Stil, wie ein Text komponiert ist, welchen Rhythmus er hat. Ich vermisse oft die künstlerische Auseinandersetzung mit einem Text, eine ästhetische Reflexion über das Werk.
Ihre zweite Passion neben der Literatur gilt dem Theater. Noch vor Ihrem Germanistikstudium absolvierten Sie die Schauspielschule. Warum verfolgten Sie die darstellende Kunst nicht weiter?
Die Ausbildung am damaligen Bühnenstudio enttäuschte mich. Der Unterricht fiel oft aus, weil die Schauspieler, die dozierten, Proben hatten. Doch ich mochte das Rollenstudium, den Gesangsunterricht. Parallel bildete ich mich zur Sekundarlehrerin aus, weil mein Vater fand, ich müsse auch einen seriösen Beruf haben. Als mir eine Rolle am Theater St. Gallen angeboten wurde, in «Das lange Weihnachtsmahl» von Thornton Wilder, sagte ich aber sofort zu. Ich spielte wahnsinnig gerne. Doch die Proben bestanden aus viel zu viel Abwarten. Mit der Zeit dachte ich: In diesem Beruf verwartest du dein Leben. Und du bist unglaublich abhängig. Die Freude, aus Texten eine Figur zu formen, hatte mich zum Theater geführt. Etwas Analoges glaubte ich im Studium der Germanistik und Anglistik zu erfahren – wegen Schiller und Shakespeare.
Hat Sie das Schauspiel später als Germanistin in irgendeiner Form beeinflusst?
Vielleicht in der Art, in einen Text hineinzusteigen. Und dann dem Text auf die Spur zu kommen. Das Einsteigen in eine Figur, sie auseinanderzufalten, sie schliesslich zu formen, das funktioniert ähnlich.
Wie lesen Sie als Kritikerin?
Ich liefere mich dem Text aus, wenn ich ihn zum ersten Mal lese. Nehme möglichst ohne Vorurteil wahr, was er mir sagt. Dabei entsteht langsam ein Eindruck, den ich in Notizen festhalte, aber in einer zweiten Lektüre verifiziere. Häufig kommen mir dann nachts Erkenntnisse; auch zum Ablauf eines Aufsatzes oder einer Rezension. Befasst man sich mit einem Buch für eine gewisse Zeit, ist das eine Art Identifikation, bei aller geforderten kritischen Distanz.
Was lesen Sie aktuell?
«Sturz in die Sonne» von C. F. Ramuz. Das Werk ist ja erst vor zwei Jahren auf Deutsch erschienen. Auch las ich es kürzlich wieder auf Französisch: «Présence de la Mort». Und gerade habe ich «Seinetwegen» von Zora del Buono gelesen.
Man spürt bei Ihnen noch immer eine lebhafte Begeisterung für Ihr Metier. Was treibt Sie weiterhin an?
Das interessiert mich einfach: Literatur, Theater, Kunst. Mir ist das nie verleidet. Aktuell bestreite ich regelmässig das «Literaturfenster am Hottingerplatz» in Zürich, wo ich mich in ein Thema vertiefe, dazu vortrage und lese. Die nächste Veranstaltung heisst: «C. F. Ramuz zwischen Archaik und kubistischer Moderne». Ich hatte immer Angst vor Routine. Gelegentlich beobachtete ich Kritiker, die mit der Zeit beim Schreiben nur noch ein Programm abspulten. Die sich einem spezifischen Text gar nicht mehr stellten. Das wollte ich vermeiden. Bei jedem Text versuche ich, neu anzusetzen.
Beatrice von Matt-Albrecht, aufgewachsen in Stans, promovierte 1964 bei Emil Staiger über «Die Lyrik Albin Zollingers». Seit Jahrzehnten prägt sie den Diskurs über Literatur in der Schweiz. Sie erhielt unter anderem den Innerschweizer Kulturpreis, zusammen mit Peter von Matt (1994) und die Goldene Ehrenmedaille des Kantons Zürich (2022).